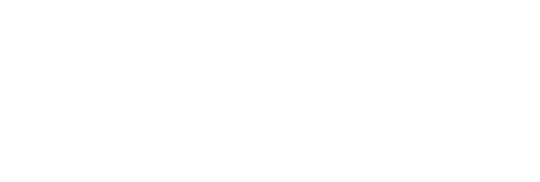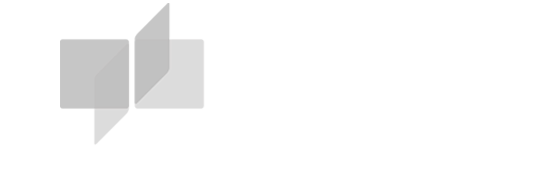Der Club of Rome hat „die Grenzen des Wachstums“ aufgezeigt. Damit wir weiter wachsen können! Bislang bedeutet(e) Wachstum in unserem kapitalorientierten System „Schneller, höher, weiter“, kurz und bündig: „(immer) mehr“. Wenn Umsatzzahlen oder Gewinn eines Unternehmens stagnieren oder unter dem Wert der vorangehenden Periode liegen, wird dies negativ bewertet, der Unternehmenswert sinkt. Wer „gut“ sein will, versucht das zu vermeiden und muss also … wachsen. Aber muss das so sein? Und heißt nicht, die Grenzen des Wachstums zu akzeptieren, überhaupt erst Raum zu schaffen, dass vieles weiter wachsen kann?
Wer die Spiele „Risiko“ oder „Monopoly“ einmal gespielt hat, weiss, was Wachstum auf einem begrenzten Raum und mit begrenzten Resourcen bedeutet: Einer wächst, alle anderen gehen ein. Bei Maja Göpel habe ich gelesen, dass das Spiel „Monopoly“ ursprünglich erfunden wurde, um genau dies spielerisch klar zu machen. Aber die Freude am Besiegen überwog die Trauer beim Verlieren und so hat diese Lehre dieses weltweit verbreiteten Spiels wohl nur untergeordneten Charakter. Es ist ja auch nur ein Spiel, das beliebig wiederholt werden kann.
Anders ist es mit dem Leben für uns Menschen auf diesem Planeten. Um zu zeigen, wie ein System verändert werden kann, indem man seine Regeln ändert oder einschränkt, gab es alternative Varianten von Monopoly. Die sind aber als Spiel nicht so attraktiv, weil gewinnen dort eben nicht bedeutet, alle anderen zu besiegen und haben sich bisher kaum durchgesetzt.
Dennoch: Seit etwa 15 Jahren haben vermehrt (haptische) Multiplayer-Spiele auf den Markt gefunden, in dem die Spielenden gemeinsam gegen eine (virtuelle) Konkurrenz kämpfen. Angefangen vom „Obstgarten“, wo Spielende die Früchte vor einem gierigen Raben in Sicherheit bringen, bis hin zu „Die verlorene Insel“, wo sie gemeinsam die Flut auf einer versinkenden Insel besiegen müssen. In beiden Fällen geht es darum, dass am Ende alle bestehen und nicht einer allein den Gewinn nach Hause trägt oder überlebt, während die anderen „sterben“. Das Gefühl und die Gesamtstimmung nach solchen Spielen war in unserer Familie schon immer ein besseres, als wenn einer über alle anderen triumphierte und diese ausschieden und sich – mehr oder weniger – ärgerten.
Ich kenne inzwischen sogar Unternehmer und Unternehmerinnen, die über ihr Unternehmen sagen: Wir wollen gar nicht mehr wachsen. Wir wollen dafür sorgen, dass wir ein sicheres Einkommen haben, das aus einem sicheren Umsatz resultiert. Unsere Prozesse sind organisiert. Wir nehmen Neues auf, aber wir sind zufrieden mit dem, was wir haben. Wir brauchen kein „mehr“.
Gibt es inzwischen genügend Platz für solche Unternehmen? Können Sie Bestand haben in einem System, in dem es noch immer besser ist, die Parkstraße zu besitzen und dort 4 Hotels stehen zu haben? Was muss ich ändern, damit das funktioniert?
Wie können wir Ihnen in Ihrem Projekt helfen? Beschreiben Sie uns kurz, was Sie vorhaben.